

|
 |
|
 |
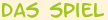
|
 |
| |
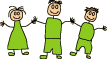 "Wer nicht spielen lernt,
lernt nicht lernen." "Wer nicht spielen lernt,
lernt nicht lernen."
(W.
Menzel)
Das Spiel und insbesondere das freie Spiel,
hat für uns eine große Bedeutung im Kindergartenalltag.
Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf
eines jeden Kindes, das die Umwelt, sich selbst,
bestimmte Situationen und Beobachtetes zu begreifen
versucht.
| Spielen bedeutet
Erwerb von Kompetenzen: |
 |
Im Spiel verarbeiten Kinder,
was ihnen passiert und begegnet. Sie leben Ängste
aus und finden Lösungen. |
 |
Die Kinder lernen sich im Spiel selbst kennen.
Ihre Fähigkeiten und auch Schwächen
und sie lernen mit beidem umzugehen. |
 |
Durch das gemeinsame Spiel werden die Kinder
im Sozialverhalten gefördert und gefordert.
Sie müssen sich mit anderen auseinandersetzen,
sich durchsetzen oder nachgeben, mit den Spielpartnern
kommunizieren. Konsequenzen tragen, Konflikte
austragen und verarbeiten. |
 |
Im Spiel herrschen Regeln (vorgegebene oder
selbst festgelegte), diese müssen akzeptiert
werden. Die Kinder lernen die Regeln einzuhalten
und die Konsequenzen zu tragen, wenn Regeln
gebrochen werden. Die großen bringen
den Kleinen die Regeln bei. |
 |
Die Selbstständigkeit wird gefördert.
Die Kinder müssen entscheiden, mit wem,
wo, wie lange und was sie spielen wollen. |
 |
Im Spiel wird die Motorik gefördert.
Sie wird in allen Spielen benötigt, egal
ob beim bauen, basteln, malen, schneiden, Spielfiguren
bewegen, fädeln, stecken… |
 |
Das Selbstvertrauen wird gestärkt.
Das Kind erlebt, dass das Erreichte mit der
eigenen Anstrengung und dem eigenen Können
verbunden ist. |
 |
Im Spiel entwickelt sich das Verständnis
für die Realität. Der Psychomotoriker
Jürgen Seewald prägte den Satz: "Nur
wer einen Stein geschleppt hat, weiß was
ein Stein ist". Das Wissen und die Vorstellung
von etwas, kommen aus dem Handeln und der körperlichen
Erfahrung. |
 |
Im Spiel finden die Kinder Lösungen
für ihre Fragen und es entstehen neue
Fragen um die Welt zu begreifen. |
"Alles, was wir die Kinder lehren, können
sie nicht mehr selbst entdecken und damit wirklich
lernen". (Piaget)
Somit
ist für uns die Freispielzeit immer
auch Lernzeit. Wir versuchen die Voraussetzungen
für das
selbstständige Spielen zu schaffen und Spielbereiche
so interessant zu gestalten,
dass die Kinder einen
Anreiz zum Spielen und somit zum Lernen bekommen.
Wir
müssen Freiräume schaffen, in denen
sich die Kinder ungehindert entfalten können.
Bewegungsräume, in denen sie sich auf vielfältige Art bewegen können.
Handlungsräume, in denen die Kinder aktiv sein und experimentieren können.
Erfahrungsräume, in denen sie Neues entdecken und erforschen können.
Phantasieräume, in denen die Kinder kreativ werden können und Spaß haben.
Die
Freispielphase bietet zudem die gute Möglichkeit,
einzelne Kinder oder Kleingruppen zu beobachten.
Stärken und Schwächen kristallisieren
sich heraus, auf die dann angemessen reagiert und
eingegangen werden kann.
Interessen zeigen sich, die sich wiederum als Thema
aufgreifen und in gezielten Angeboten vertiefen
lassen.
"Noch nie hatten Kinder so viele Sachen
zum Spielen, noch nie gab es so viele Einrichtungen,
die sich
um ihre Aktivitäten kümmern wie heute.
Noch nie waren Kinder allerdings so arm an Möglichkeiten,
sich ihrer Umwelt über ihre Sinne, ihren Körper
zu bemächtigen …"
(Zimmer, 1993)
|
|
|
|
|
|